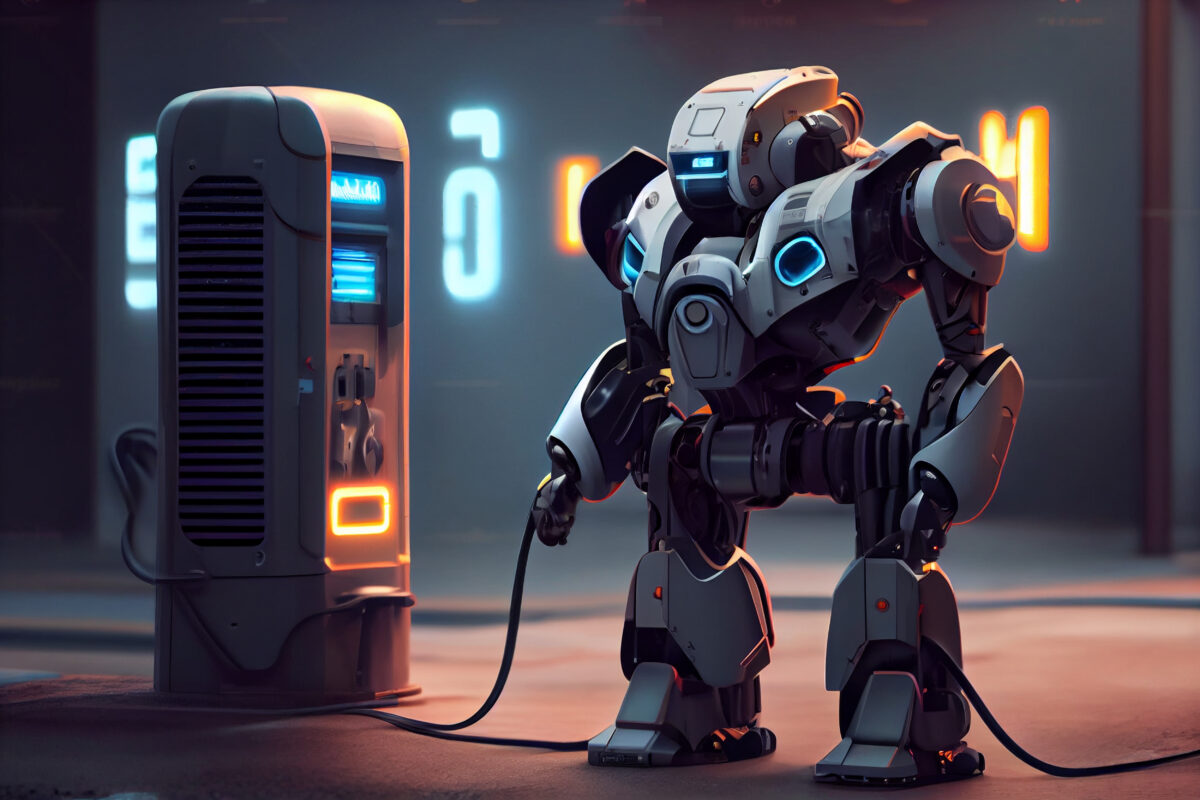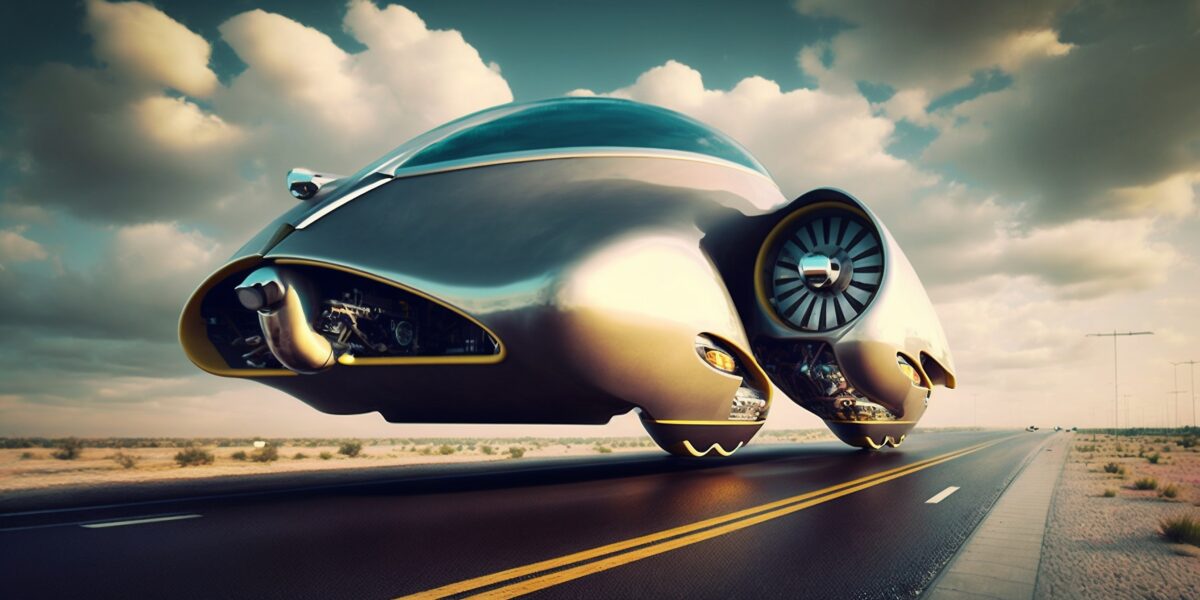- 18. März 2024
- Sicherheit & Praxis
- Elmar Brümmer
Die Welt hat es geschnallt
Der Sicherheitsgurt feiert Jubiläum

Es ist eine Handbewegung, die einem längst in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie das Zähneputzen oder das Entsperren des Mobiltelefons: Einsteigen ins Auto, hinter sich greifen, Gurt anlegen. Die Hinweisschilder „Erst gurten, dann starten“ braucht es heute kaum noch, die Anschnallquote liegt bei 98 Prozent. Trotzdem sind unter den Verkehrstoten immer noch gut zehn Prozent dabei, die eben nicht angeschnallt waren. Aber heute gilt es, den Jubilar unter den Lebensrettern zu feiern: 1974 wurde erst der Einbau von Sicherheitsgurten in Deutschland vorgeschrieben, die allgemeine Anschnallpflicht folgte zwei Jahre später. Ein Produkt, wie gemacht für den aktuellen Slogan der GTÜ: Technik braucht Sicherheit.

Im Auto gefesselt
Was heute Selbstverständlichkeit ist, war vor 50 Jahren jedoch nicht unumstritten. Selbst prominente Juristen und bekannte Chefredakteure weigerten sich, den Gurt anzulegen, „oben ohne“ galt als cool, falls es das Modewort damals schon gegeben hat. Lediglich ein Drittel der Autofahrer folgte dem neuen Gesetz, „Gurtmuffel“ durfte man offenbar völlig ungeniert sein. Ängste wurden geschürt, dass Gurte die Hemden zerknittern würden oder der Busen plattgedrückt werden könnte. Freiheitsliebende beklagten die „Fesseln im Auto“.
Endlich macht es „Klick“
Doch die Technik und die Unfallstatistik führten schnell zu einem Sinneswandel, zehn Jahre später kamen auch die Gurte für die Rücksitze. Zeitgleich wurden Bußgelder eingeführt, das große Umdenken begann. Es hatte „klick“ gemacht. Heute werden läppische 30 Euro für den fällig, der sich nicht anschnallt. Angesichts der lauten Warntöne dürfte das aber seltener vorkommen. Wer Kinder nicht richtig sichert, muss mehr berappen.

Was James Dean damit zu tun hat
Schon in den 1930er Jahren hatte amerikanische Ärzte sich in ihre Autos Gurte einbauen lassen, auch bei Rennfahrern waren sie üblich. Das erste entsprechende Gesetz in den USA stammt von 1955. Als wenige Monate später der Kinorebell James Dean in einem offenen Porsche ums Leben kam, diskutierte das ganze Land darüber, ob er mit Gurt überlebt hätte. Das half der Sicherheitskampagne entscheidend, US-Hersteller begannen ihre Neuwagen entsprechend umzurüsten.
Die beste Idee kommt aus Schweden
Der Sicherheitsgurt wird zu einer der acht wichtigsten Erfindungen gezählt, die der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Konstruiert wurde das bis heute übliche Insassenschutz-System 1958 von einem schwedischen Flugzeugingenieur, der um die hohen Aufprallkräfte wusste. Er tüftelte an einem neuen System, das sowohl die Hüften als auch den Oberkörper am Autositz halten sollte und sich mit nur einer Hand bedienen lassen konnte. Volvo brachte den aus dieser Überlegung heraus entstandenen Dreipunkt-Gurt schnell zur Serienreife, es festigte den sicheren Ruf der Marke.
Lebensretter Nummer Eins
Obwohl auch für die Konkurrenz freigegeben, dauert es lange, bis über Sportwagenhersteller und Limousinen-Fabrikanten die Massenproduktion darauf einstieg. Die Erfinder schätzen, dass in den letzten fünf Jahrzehnten mehr als eine Million Menschenleben durch das so genannte „passive Rückhaltesystem“ gerettet worden sind. Im Zusammenspiel mit den Airbags erhöht sich die Sicherheit noch. Ein Irrglaube allerdings, das würde ohne Gurt funktionieren. Er bleibt der Lebensretter Nummer Eins.