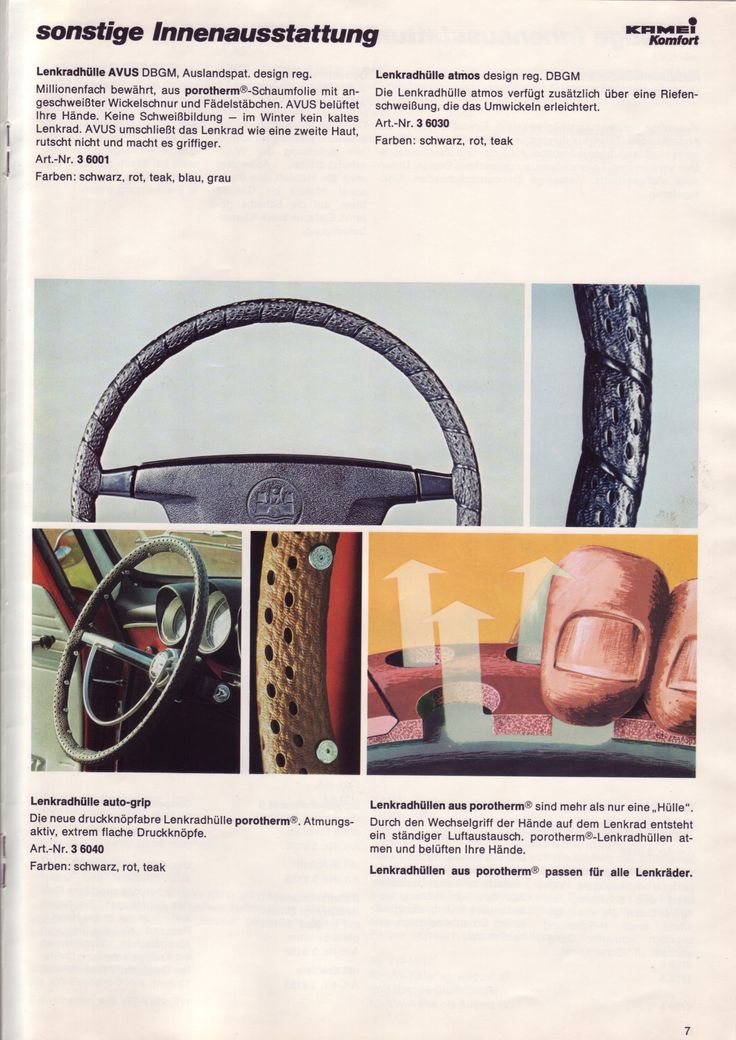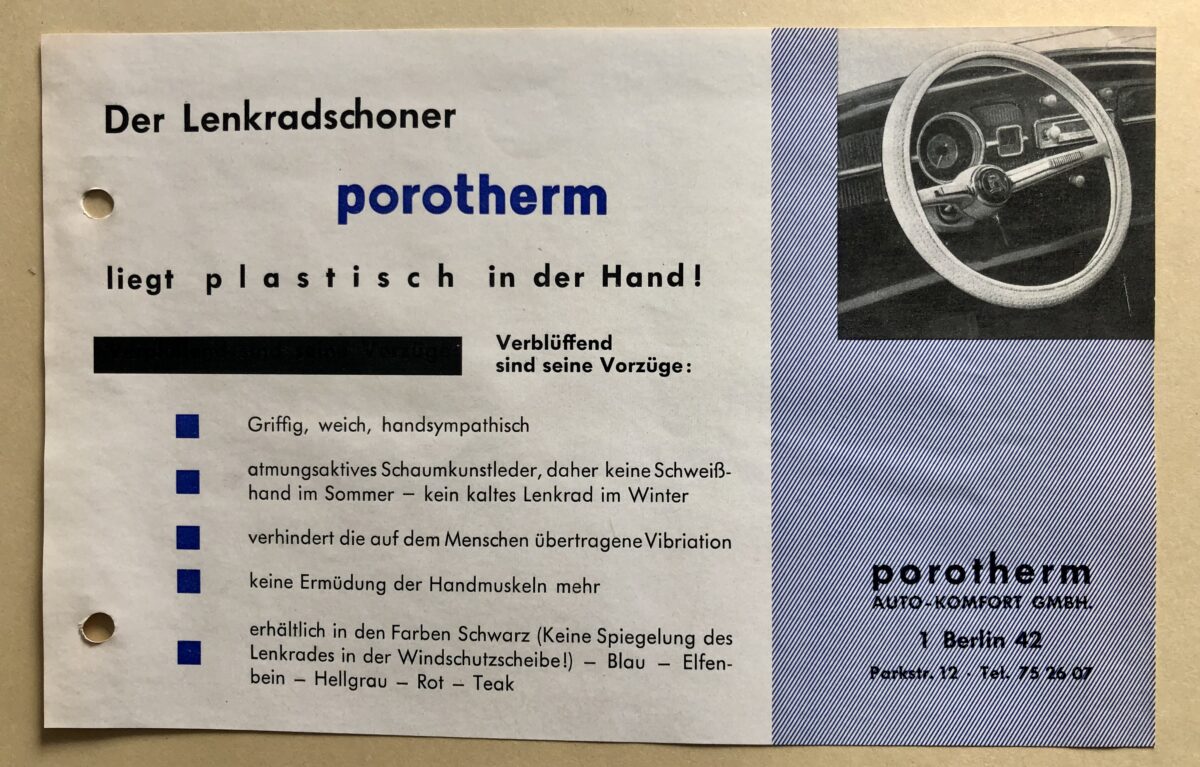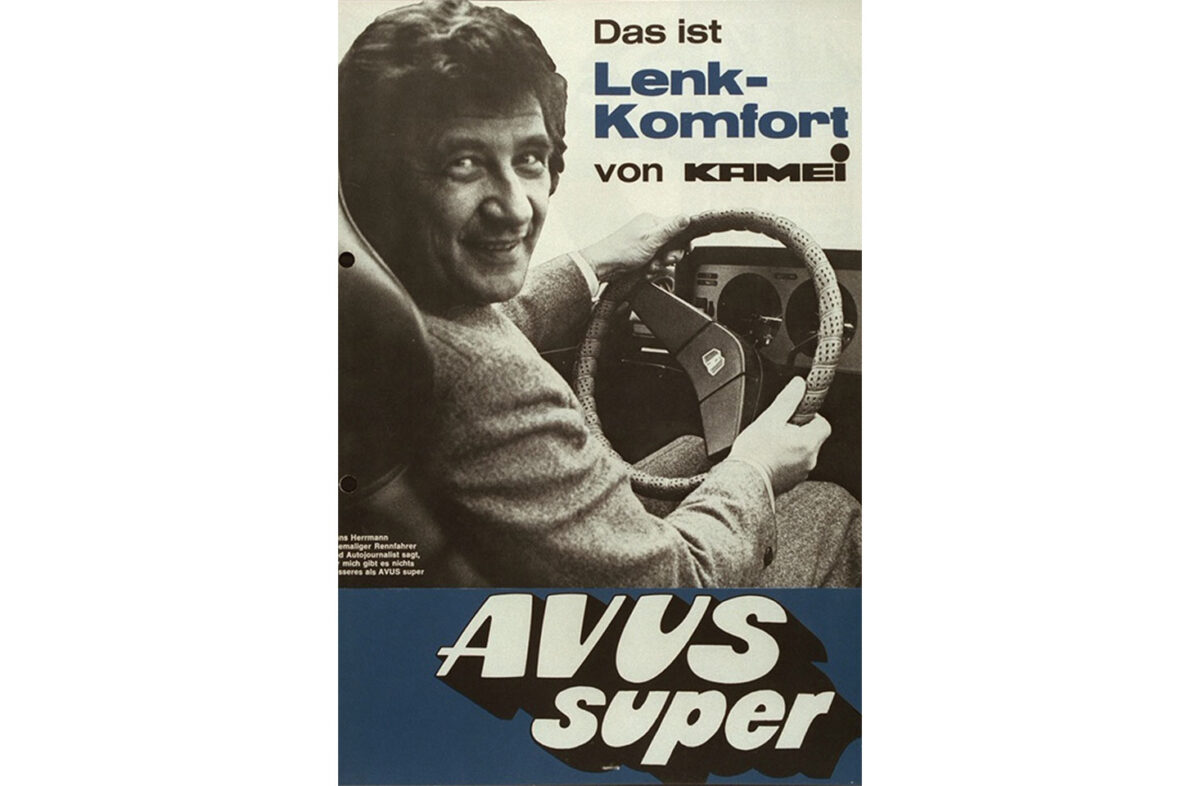- 04. Juli 2025
- Tradition & Innovation
- Christian Steiger
Vor 60 Jahren: Die Rückkehr von Audi
Mercedes wird zum Entwicklungshelfer

Die vier Ringe sind keinen Pfennig mehr wert, als Volkswagen die Auto Union kauft. Mit dem Mitteldruck-Motor von Mercedes wird im Sommer 1965 die Marke Audi daraus. Wenn er es halbwegs diplomatisch ausdrücken will, dann spricht Ludwig Kraus „von einem nicht ganz gelungenen Auto mit einem nicht ganz gelungenen Motor“. Erfolgreich war es trotzdem.
Scheidung auf Schwäbisch
Vor allem damit rechnet keiner, als der Mercedes-Ingenieur Kraus 1963 zur Auto Union nach Ingolstadt kommt. Der Stern und die vier Ringe gehören damals zusammen, der Unternehmer und Investor Friedrich Flick hat den Deal 1958 eingefädelt. Doch eine glückliche Ehe ist es nicht, weil die Partner völlig unterschiedlich ticken. Die Mercedes-Entwickler wissen genau, dass der Zweitakt-Motor keine Zukunft mehr hat, sie pochen auf die Entwicklung eines Viertakters. Das kommt für die Hüter der Marke DKW nicht in Frage, lieber knattern sie 1963 mit dem neuen F 102 ins Verderben: Der ist mit seinen 60 PS zwar flott unterwegs, doch er nervt mit Motorschäden. In Stuttgart greifen sie jetzt durch und schicken Ludwig Kraus nach Ingolstadt.

Foto: Audi
Ein Hybrid-Motor aus dem Regal
Es muss schnell gehen, für die Entwicklung eines ganz neuen Motors ist keine Zeit. Kraus nimmt eine Konstruktion mit, die Mercedes in den Fünfzigern schon mal erprobt und verworfen hat: ein hoch verdichtetes Mittelding aus Benziner und Diesel, zu erkennen an den schneckenförmigen Drallkanälen im Ansaugtrakt. Die sollen eine besonders effiziente Verbrennung und damit einen niedrigen Verbrauch möglich machen. Genau richtig, um das Vertrauen der DKW-Kunden zurückzugewinnen – und die Auto Union an einen solventen Käufer loszuwerden.

Foto: Audi
Neuer Marke, alter Name
Der neue Hausherr ist schnell gefunden: In Wolfsburg sucht VW-Chef Heinrich Nordhoff nach neuen Werken, um die Welt mit noch mehr Käfern beglücken zu können. Die DKW-Produktion würde er am liebsten einstellen, doch zur Marke gehört ein Händlernetz, das sich nicht einfach auflösen lässt. Und womöglich verhindert das neue Modell aus Ingolstadt ja auch, dass aufstrebende VW-Kunden zu Opel oder Ford abwandern. Fehlt nur noch ein passender Name. Den findet nicht Nordhoff, sondern seiner junger Verkaufschef Carl Horst Hahn: Er schlägt vor, die Vorkriegs-Marke Audi zu reaktivieren.

Foto: Audi
Ein kleiner Ersatz-Mercedes
Der Audi ist ein Audi ist ein Audi, denn er trägt anfangs noch nicht mal eine Modellbezeichnung. Später wird der Audi dann zum 60, 75, 80 und sogar zum Super 90 werden, weil Mercedes und VW mit Hilfe von Ludwig Kraus die richtige Marktlücke gefunden haben. Mit dem neuen, 72 PS starken Vierzylinder, den die Werbung zum „Mitteldruckmotor“ macht, mit dem komfortabel abgestimmten Fahrwerk und der akkuraten Verarbeitung überzeugt er Käufer, die damals noch vergeblich von einem kleinen Mercedes träumen.

Foto: Audi
Das Sparmodell läuft am besten
Das Versprechen der Sparsamkeit kann der Mitteldruck-Motor allerdings nicht erfüllen, nur im Teillastbereich verbraucht er etwas weniger als seine Wettbewerber. Das Laufgeräusch klingt vergleichsweise herb und Dauervollgas kann zu Rissen im Zylinderkopf führen. Aus heutiger Sicht wirkt so ein früher Viertakt-Audi außerdem schmal und frugal, doch auch das steht seinem Erfolg nicht im Weg. Ganz im Gegenteil, der Audi erobert auch Opel- und Ford-Käufer, die genug haben von den schnellen Modellwechseln und der manchmal lässigen Verarbeitung der deutschen US-Konzerntöchter.
Der Käfer muss weichen
Die Entwicklung der Audi-Modellfamilie verläuft so evolutionär, wie es die meist nicht mehr ganz jungen Kunden mögen, am erfolgreichsten ist er sowieso als Sparmodell Audi 60. Insgesamt verkaufen sich die Mitteldruck-Modelle bis 1972 über 400.000 mal und finanzieren damit die Entwicklung des Audi 100. Mit dem steigt die Marke ab 1968 zum Mercedes-Gegner auf. Und schon 1969 ist geschafft, was vier Jahre vorher niemand für möglich hält: Die Audis haben den Käfer von den Ingolstädter Produktionsbändern gedrängt.

Foto: Audi